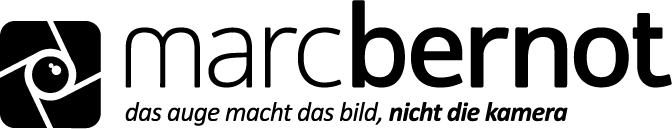Libertärer Literaturpreis
von eigentümlich frei
Jetzt teilnehmen!

Libertärer Literaturpreis 2024
Preisgeld: 30 Gramm Gold / 20 Gramm Gold / 10 Gramm Gold
Unterstützt vom informellen „Freundeskreis Literatur libertär“ (Interessenten dürfen sich gerne melden), lobt die Zeitschrift eigentümlich frei im Jahr 2024 zum fünften Mal einen Literaturpreis aus. Sieger waren 2020 Helge Pahl, 2021 Jan Reindl, 2022 André Jasch und 2023 Bernd Zeller. Der Sieger 2024 erhält 30 Gramm Gold, der zweite Platz 20 Gramm Gold und der Drittplatzierte 10 Gramm Gold Preisgeld. Die drei Gewinner werden im Rahmen der achten großen ef-Konferenz vom 15. bis 17. November 2024 auf Usedom ausgezeichnet. In diesem Jahr bitten wir um eine Kurzgeschichte zum Arbeitsthema „Politik ist nicht die Lösung!“. Gewünscht ist ein – gerne humorvoller – fiktionaler Beitrag in der Länge von 10.000 bis 50.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen). Teilnahmeberechtigt sind alle, die Freude am Schreiben und an einer Geschichte haben, die zum Thema passt. Ausgewählte Kurzgeschichten werden veröffentlicht. Bitte senden Sie Ihren Wettbewerbsbeitrag bis zum 30. Juni 2024 per E-Mail mit Dateianhang und ein paar kurzen Angaben zur Person an: lichtschlag@ef-magazin.de
Wir freuen uns auf Ihre Geschichte!
Politik ist nicht die Lösung!
CAROLINWOMAN
Der Siegerbeitrag zum Libertären Literaturpreis 2023

Das Werk „Carolinwoman“ von Bernd Zeller ist eine humorvolle und zugleich tiefgründige Geschichte, die das Abenteuer eines jungen Mädchens namens Carolin erzählt. Carolin navigiert durch die Herausforderungen des Alltags und die Dynamiken zwischen Kindern und Erwachsenen, während sie gleichzeitig mit der Idee von Superkräften und der eigenen Identität jongliert.
Die Erzählung beginnt mit Carolins Überlegungen zum Wert von Geheimnissen und führt uns in ihr Leben ein, das geprägt ist von kindlicher Neugier und der Suche nach ihrer Rolle in der Welt. Auf einem Geburtstagsfest trifft sie auf Luis, einen Jungen, der überzeugt ist, eine Superkraft zu besitzen, auch wenn er noch nicht herausgefunden hat, welche es ist. Dieser Glaube an außergewöhnliche Fähigkeiten wirft Fragen auf über das, was uns besonders macht und wie wir uns in der Gesellschaft positionieren.
Die Geschichte zeichnet sich durch eine Reihe von alltäglichen und zugleich außergewöhnlichen Begegnungen aus, die Carolin dazu bringen, über ihre eigenen Fähigkeiten und die Bedeutung von Freundschaft, Mut und Selbstakzeptanz nachzudenken. Sie konfrontiert die Leser mit der Idee, dass wahre Superkräfte vielleicht weniger in spektakulären Fähigkeiten liegen als vielmehr in der Kraft der Empathie, der Kreativität und der Fähigkeit, sich für andere einzusetzen.
Im Verlauf der Geschichte entdeckt Carolin, dass die wahren Helden des Alltags jene sind, die sich den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens stellen, ohne dabei ihre Menschlichkeit zu verlieren. Sie lernt, dass wahre Stärke oft in der Fähigkeit liegt, sich selbst und anderen gegenüber ehrlich zu sein, und dass jeder auf seine Weise über besondere Talente verfügt.
„Carolinwoman“ ist somit mehr als nur eine Kindergeschichte; es ist eine Reflexion über die Bedeutung von Identität, Freundschaft und dem Mut, sich selbst treu zu bleiben. Bernd Zellers Werk fordert junge wie erwachsene Leser dazu auf, über die wahren Werte im Leben nachzudenken und zeigt, dass Heldentum in vielerlei Formen existiert.
Bernd Zeller Gewinner 2023
Bernd Zeller ist Karikaturist, Verfasser des Lehrbuchs „Komik und Satire“, Betreiber der Online-Satirezeitung zellerzeitung.de, ehrenamtlicher Macher der Jenaer Seniorenzeitung „Rentnerisches Akrützel“, vormaliger „Titanic“-Redakteur, zwischenzeitlicher Neugründer von „Pardon“ sowie Mitbegründer der Jenaer Studentenzeitung „Studentisches Akrützel“. Er zeichnete unter anderem für „Thüringer Allgemeine“, „Die Welt“, „Süddeutsche Zeitung“ und schrieb Gags für die Harald Schmidt Show. 2023 gewann er den Libertären Literaturpreis mit diesem Beitrag.
NICHTS ALS DIE WAHRHEIT
Der Siegerbeitrag zum Libertären Literaturpreis 2022

„Nichts als die Wahrheit“ von André Jasch ist eine tiefgründige Erzählung, die sich mit den Herausforderungen des Journalismus, der Suche nach Wahrheit und der menschlichen Kapazität für Empathie und Veränderung auseinandersetzt. Der Protagonist, ein junger Journalist namens Arkadi, befindet sich in einem Dilemma zwischen seiner journalistischen Integrität und dem Wunsch, die Welt zu verändern. Auf einer Preisverleihung reflektiert er über seine Karriere und die Ereignisse, die ihn zu diesem Punkt geführt haben, während er mit verschiedenen Gästen interagiert, darunter Ulrich „Ulli“, ein erfahrener Reporter.
Arkadi teilt mit Ulli und dem Leser seine Erfahrungen, die von der anfänglichen Naivität über die harte Realität der Kriegsberichterstattung bis hin zu einer tiefen Krise reichen, die durch das tragische Schicksal einer verschleppten und schließlich in einem Brand umgekommenen Flüchtlingsmädchen, Nayla, ausgelöst wird. Arkadi hatte gehofft, durch seine Berichterstattung Veränderungen bewirken zu können, wird aber von der harten Realität eingeholt, die zeigt, dass journalistische Bemühungen oft an politischen und gesellschaftlichen Grenzen scheitern.
Der Roman kritisiert die Sensationslust und Oberflächlichkeit der Medienlandschaft und stellt die Frage, was es bedeutet, in einer Welt, in der Nachrichten zunehmend von Misstrauen, Desinteresse oder gar Ablehnung begleitet werden, ein Journalist zu sein. Durch die Augen Arkadis und seiner Interaktionen, insbesondere mit Ulli, werden Themen wie Verantwortung, ethische Grenzen des Journalismus und die persönliche Belastung durch die Konfrontation mit Leid und Ungerechtigkeit behandelt.
Im Laufe der Handlung wird deutlich, dass Arkadi trotz der Zweifel und der erlittenen Verluste seine Mission nicht aufgibt, der Wahrheit eine Stimme zu geben. Seine Geschichte ist eine Hommage an den Journalismus als Berufung, gekennzeichnet durch das ständige Ringen um Wahrheit, Authentizität und Menschlichkeit. Der Beitraf endet mit einer Preisverleihung, auf der Arkadi trotz seiner inneren Konflikte und der Skepsis gegenüber der Bedeutung solcher Auszeichnungen den Preis für die Reportage des Jahres erhält und ihn dem Andenken Naylas widmet. Dieser Moment unterstreicht die Ambivalenz des Protagonisten gegenüber seinem Erfolg und der Rolle der Medien in der Gesellschaft, während er gleichzeitig die Hoffnung nicht aufgibt, dass Geschichten wie die seine letztendlich doch einen Unterschied machen können.
André Jasch Gewinner 2022
André Jasch wurde in Brandenburg an der Havel geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Berlin und Neurowissenschaften in Osnabrück. Er absolvierte 2017 eine einjährige Autorenausbildung im „Haus des Schreibens“ in Berlin, geleitet von Julia Powalla, das in der Anthologie „Ging mir nie besser“ mündete. Außerdem nahm er an einem von Kathrin Lange geleiteten Schreibseminar zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls teil, das zur Anthologie „Der geheilte Himmel“ führte. Heute hat er seinen Lebens- und Schaffensmittelpunkt wieder in Berlin. Dort verdient sich der gebürtige Havelländer seine Brötchen als Redakteur. Wenn er nicht gerade in den Untiefen der Finanzwelt recherchiert, dann schreibt er an seinem ersten Roman. Seine Neugier gilt dabei jungen Pianisten, alten Lektoren und dem Braunkohleabbau – ein Gesellschaftsroman ist im Entstehen.
RESILIENZ
Der Siegerbeitrag zum Libertären Literaturpreis 2021

„Resilienz“ von Jan Reindl erzählt die Geschichte eines Spähers, der in einer dystopischen Zukunft lebt, in der Menschen in einer streng kontrollierten Gesellschaft innerhalb einer gigantischen Pyramidenstadt leben. Jeder Einzelne ist mittels einer neuronalen Schnittstelle in ein kollektives Bewusstsein eingebunden, das von einem Zentralrechner gesteuert wird. Der Protagonist, ursprünglich Teil dieser Gesellschaft, findet sich nach einem Angriff außerhalb der Stadt wieder, isoliert von dem Kollektivbewusstsein und seiner Gruppe. In der Wildnis beginnt er, die Realitäten seiner Existenz und die Bedeutungen von Freiheit und Individualität zu hinterfragen.
Nachdem er von einer Frau namens Lia gerettet und seiner neuronalen Schnittstelle beraubt wird, erlebt er die Welt außerhalb der Stadtgrenzen erstmals bewusst. Lia öffnet ihm die Augen für eine Welt, die frei von der Kontrolle durch den Zentralrechner ist, und lehrt ihn, das Leben außerhalb der restriktiven Gesellschaft zu schätzen. Der Protagonist entscheidet sich, nicht in die Stadt zurückzukehren, sondern sein neues Leben in Freiheit zu erforschen. Er nimmt den Namen William an und widmet sich der Aufgabe, anderen Bewohnern der Pyramide zu helfen, ebenfalls zu entkommen und die Wahrheit über ihre Welt zu entdecken.
Das Werk untersucht Themen wie Autonomie, das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und die Frage, was es wirklich bedeutet, frei zu sein. Es ist eine tiefsinnige Reflexion über die menschliche Natur, den Wert individueller Freiheit gegenüber kollektiver Sicherheit und die Suche nach Identität in einer überwachten und kontrollierten Gesellschaft.
Jan Reindl Gewinner 2021
Jan Reindl ist Lehrer und gewann 2020 mit einer Science-Fiction-Kurzgeschichte den Libertären Literaturpreis. In ef 202 schrieb er zuletzt über „Politik in Zeiten der Pandemie: Begeht die Regierung eine Dummheit?“.
LEEWER DUAD ÜS SLAAV
Der Siegerbeitrag zum Libertären Literaturpreis 2020

„Leewer duad üs slaav“ von Helge Pahl ist ein literarisches Werk, das eine spannende Geschichte aus zwei unterschiedlichen Zeitperioden erzählt, die auf faszinierende Weise miteinander verwoben sind.
Im ersten Teil der Erzählung befinden wir uns im späten 19. Jahrhundert in Berlin, wo der neue Reichskanzler von Caprivi mit den Herausforderungen seiner Amtszeit konfrontiert wird, insbesondere mit der bevorstehenden Unterzeichnung eines bedeutenden Vertrages, der die Neuordnung der deutschen und britischen Einflusssphären in Afrika regelt. Dieser historische Kontext wird lebendig durch die Darstellung politischer Manöver, diplomatischer Spannungen und der strategischen Bedeutung der Insel Helgoland, die Deutschland im Austausch für territoriale Konzessionen in Afrika von Großbritannien erwerben möchte. Die Komplexität internationaler Beziehungen und die machtpolitischen Spiele der Zeit werden durch die Figur des Reichskanzlers und seiner Auseinandersetzung mit den Briten und dem Sultan von Witu anschaulich dargestellt.
Der zweite Teil versetzt den Leser in das Jahr 2024, auf die Insel Helgoland, die von einer schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise gezeichnet ist. Im Mittelpunkt steht Freerk Rickmers, ein gebürtiger Helgoländer, der nach Jahren im Ausland auf die Insel zurückkehrt. Die Beschreibungen seines Heimkehrerlebnisses und der Veränderungen auf Helgoland zeichnen ein eindrückliches Bild der Auswirkungen der Globalisierung und ökonomischer Verwerfungen auf lokale Gemeinschaften. Rickmers' Begegnungen und Gespräche mit alten Freunden und Verwandten führen schließlich zu einem radikalen Plan: die Unabhängigkeitserklärung Helgolands, inspiriert durch historische Verträge und das unerschütterliche Streben nach Selbstbestimmung.
Der Roman thematisiert zentrale Fragen der Identität, Zugehörigkeit und des politischen Selbstverständnisses. Er verwebt geschickt historische und zeitgenössische Ereignisse, um eine Geschichte von Widerstand, Freiheitsstreben und der Bedeutung von Heimat zu erzählen. Die Charaktere, sowohl historische als auch fiktive, sind tiefgründig und facettenreich gestaltet, ihre Motivationen und Handlungen spiegeln die komplexen Herausforderungen ihrer jeweiligen Zeiten wider.
„Leewer duad üs slaav“ ist somit nicht nur ein spannender historischer Roman, sondern auch eine tiefgehende Reflexion über die Bedeutung individueller und kollektiver Freiheit, die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und die unermüdliche Suche nach einer besseren Zukunft.
Helge Pahl Gewinner 2020
Helge Pahl erlernte den Beruf des Kunstschmieds, studierte Germanistik und Skandinavistik, ist Unternehmer, Hobbybrauer, Mitbegründer der Wacken-Brauerei und Biersommelier. Er lebt zusammen mit seiner Frau und drei Kindern in Schleswig-Holstein. 2020 gewann er mit einer Science-Fiction-Kurzgeschichte den Libertären Literaturpreis
Nehmen Sie teil
Wettbewerbsbeitrag bis zum 30. Juni 2024 per E-Mail mit Dateianhang und ein paar kurzen Angaben zur Person an lichtschlag@ef-magazin.de
Tags
Libertarismus Literatur Freiheit Preisverleihung Kunst Geschichten eigentümlich frei Freiheitsfunken